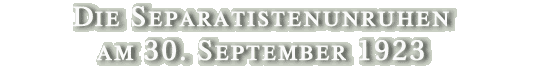
Auch die Wirtschaft hatte unter der Besatzung zu leiden. Durch den Zoll, der auf den Warenverkehr zwischen den besetzten und unbesetzten Gebieten erhoben wurde, sanken Kundenaufkommen und Profite, die Düsseldorfer Wirtschaftskraft ging rapide zurück. Dennoch, das Zusammenleben zwischen Besatzern und Besetzten normalisierte sich langsam, man begann, enger zusammenzuarbeiten.
Dies veränderte sich umgehend, als belgische und französische Truppen in das Ruhrgebiet einmarschierten. Die Regierung in Berlin rief zum passiven Widerstand in den besetzten Gebieten auf. Auf diesen reagierten die Franzosen mit Repressalien, Beschlagnahmungen und Requirierungen. Führende Beamte wurden ihres Amtes enthoben und aus den besetzten Gebieten ausgewiesen, so z.B. der Oberbürgermeister Köttgen, dessen Nachfolger Dr. Robert Lehr wurde.
Es gab aber auch Widerstand aus dem Untergrund. Stellvertretend hierfür stehen Albert Leo Schlageter, nach Sprengung der Kalkumer Eisenbahnbrücke am 15. März 1923 von den Franzosen zum Tode verurteilt und füsiliert, später von der NSDAP zum Märtyrer hochstilisiert, und Richard Raabe, im Gegensatz zum Schwarzwälder Schlageter ein geborener Düsseldorfer, der bei einem Attentat mit einer Handgranate auch unschuldige Passanten verletzte. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Als dann im September 1923 die Regierung Stresemann den Abbruch des passiven Widerstandes anordnete, erweckte dies den Eindruck, das Reich lasse das Rheinland fallen. Die Franzosen versuchten nun die Gunst der Stunde zu nutzen, um durch die von ihnen unterstützten Separatisten eine autonome Rheinische Republik zu propagieren.